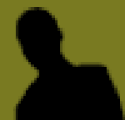7. Einheit vom 29. November 2006
Chronologie von Belgien:
1) Phase der belgischen Provinzen, partieller Aufstand
2) Union von Arras: Loyalität zu König und Katholizismus; Bruch mit den nördlichen Provinzen
3) 1598 starb Philipp II. Isabella und Albrecht übernehmen die Herrschaft und handeln 1609 einen 12-jährigen Waffenstillstand aus
4) 1621 läuft der Waffenstillstand aus. Kamphandlungen werden wieder aufgenommen, die bis 1648 dauern.
5) „Spanische Periode“, es wird weiterhin von Madrid aus regiert. Dauert bis zum Frieden von Utrecht 1713 und Rastatt 1714 – dann wird der spanische Erbfolgekrieg beendet.
6) „Österreichische Periode“, es geht nun über auf die österreichische Linie der Habsburger und dauert bis zum Revolutionsjahr 1786/89 an.
Zäsuren und Kontinuitäten:
• Katholizismus bzw. genauer die katholische Gegenreformation. Jesuiten werden als bewusstes Instrument eingesetzt, sie initiieren viele Schulgründungen. Dies darf aber auch nicht überbewertet werden, denn sie hatten kein Monopol darauf (auch Franziskaner und Dominikaner). Und Missio Hollandica wird von Rom aus stark betrieben um die nördlichen NL zu missionieren.
• Barock ist die spezifische Kunstrichtung. Weil beim Bildersturm so viel zerstört wurde hatten Barockkünstler eine gute Auftragslage.
• Wahlfahrtskirchen: wichtig für die Volksfrömmigkeit (zB Scerpenheuvel). Die Nuntiatur achtete stark darauf, ob das Konzil von Trient befolgt wurde.
• Auch die Wissenschaft wurde re-katholisiert. Unter Jean Bolland wurde eine monumentale Ausgabe von Theologen herausgebracht: Acta Sanctorum
• Einzige Religion war Katholizismus, es war wie eine Staatsreligion. Es waren zwar Protestanten die in der Garnison dienten, diese wurden geduldet, ansonsten gab es keine Toleranz. Dies war ein klarer Unterschied zur nördlichen NL, dort gab es keine Staatskirche.
• Krieg: mit 1648 wurde der 30-jährige und der 80-jährige Krieg beendet. Aber mehr oder weniger regelmäßig zogen auch danach Truppen durch Belgien.
• Wiederholte Versuche zur Zentralisierung auf Kosten der Provinzen, Zünfte und Gilden. Dagegen gab es immer Widerstand. So gab es einen Aufstand in Brüssel 1718. Höhepunkt war die Brabantische Revolution. Oft Widerstände, aber die Loyalität wurde nicht aufgekündigt. Es gab den Versuch einer engen Anbindung an die beiden Habsburger Linien. Es wurde je ein Hoher Rat eingerichtet in Brüssel um eine Kommunikationsplattform zu haben. Kaunitz sorgte in den 1750ern für eine noch engere Bindung. Er löste den Hohen Rat ab und gliederte sie in seine eigenen Kompetenzen ein.
Verwaltungsorgane:
• Generalstatthalter oder Generalgouverneur: zB Prinz Eugen von Savoyen, es ist immer ein hoher Adeliger. In Spanien war dieser Posten immer von Fluktuation gezeichnet weil er ein Durchgangsposten war. In österreichischen Zeiten änderte sich dies.
• Bevollmächtigter Minister: dies war ein hoher Karrierediplomat aus angesehener Familie. Zwar formal dem Gouverneur unterstellt, aber er hatte die Möglichkeit direkt in den Kontakt mit dem Kaiser zu treten. Dies ging auf Kosten des Gouverneurs, der nur mehr eine Repräsentationsrolle innehatte. Josef II vertraute Karrierediplomaten ohnehin viel eher als seiner eigenen Verwandtschaft, er lehnte Änderungen ab.
• Kollaterale Räte: so wie bereits 1531: Geheimer Rat, Staatsrat und Finanzrat. Karl VI versuchte dies zu ersetzen mit einem allgemeinen Regierungsrat um Kostenersparnis und Effizienzsteigerung der Bürokratie zu erzielen. Es gab aber enormen Widerstand der Bevölkerung dagegen, erst Josef II konnte hier Reformen durchsetzen.
• Auf der Ebene der 10 Provinzen: Provinzstatthalter (repräsentativ) aus einheimischem Adel. Der Kanzler war Chef der provinzialischen Verwaltung und kam aus dem niederen Adel, genauso wie Spitzenbeamte, Provinzialräte (administrativ und justiziell). Im Prinzip aus dem 16. Jh. übernommen und im Kern bis zur Revolution ihre Funktion beibehalten.
Grundzüge der Außenpolitik:
Frankreich wurde mehrfach zur Bedrohung, vor allem unter Ludwig XIV, dies hatte mit dem Niedergang der Spanier zu tun. Als Konsequenz des spanisch-französischen Krieges 1635 wurde mit dem Pyrenäen-Frieden 1659 beendet. Dabei musste Spanien einige Teile im Süden abgeben, die südliche NL wurde so deutlich reduziert. Gegen die Forderung die gesamte südliche NL an Ludwig XIV abzutreten trat Karl II aber entschieden dagegen auf. Er setzte das Devolutionsrecht ein um für seine Nachkommen die spanischen NL einzufordern. Frankreich zwang Spanien 1667/68 weitere Gebiete an Frankreich abzutreten. So wurde die südliche NL wiederum dezimiert, während sich Frankreich stabilisierte. Es gab weitere Kriege durch dynastische Zwiste im spanischen Erbfolgekrieg. Die Folgen waren beträchtlich. Spanien ging von den Habsburgern zu den Bourbonen über. Die südlichen NL wurden nun an Österreich übergeben, denn Karl II starb kinder- und erbenlos. Es gab drei Bewerber um seine Nachfolge:
1) Philipp von Anjou, der auch das Rennen macht als Philipp V. Ludwig XIV forderte nun, dass die südliche NL Frankreich angeschlossen wird und seinem Enkel übergeben wird, was enorme Machtfülle bedeutet hätte.
2) Dies rief die Habsburger auf den Plan. Für Leopold I war dies eine Bedrohung und er setzt Erzherzog Karl, den späteren Karl II ein.
3) Kronprinz Ferdinand von Bayern, der aber bald starb und so aus dem Rennen war.
Es bildeten sich zwei Machtblöcke. Auf der einen Seite stand der Kaiser, der mit England, Preußen, den nördlichen NL, dem Kurfürstentum Hannover und Savoyen verbunden war. Frankreich hingegen wurde vom Erzbistum Köln und von Bayern unterstützt. Dieser Krieg kann durchaus als der erste Weltkrieg der FN bezeichnet werden. Frankreich erwies sich – überraschenderweise – als schwächer als gedacht. Prinz Eugen und Herzog von Marlborough besetzten weite Teile der südlichen NL. Ab 1706 gab es ein Anglo-Batavisches Kondominium. Als Souverän wurde Erzherzog Karl ernannt. In Spanien wurde Karl III König, sein Spielraum war aber sehr begrenzt.
Das Ergebnis waren die Friedensschlüsse von 1713 und 1714. Dies wurde möglich, weil Philipp V auf die Erbfolge in Frankreich verzichtete und ihm nur Spanien blieb. Die Union blieb also aus, die der Rest so befürchtet hatte. Die belgischen Provinzen gingen an die österreichische Linie der Habsburger. Als Bedingung musste Österreich die 30.000 Barrieresoldaten bezahlen, was immerhin 1 Mio. Gulden pro Jahr kostete. Die Schelde blieb weiterhin geschlossen, was Hemmnisse für den Handel bedeutete. Eine weitere Einschränkung war der Umstand, dass der Überseehandel untersagt wurde – dies hatte wohlweislich England und die nördliche NL durchgesetzt.
1713 erließ Karl VI die „Pragmatische Sanktion“ um die Erbfolge zu regeln um das Reich zusammenzuhalten. 1725 ließ er dieses bestätigen, was bemerkenswert ist, weil es seit 1634 nicht mehr der Fall gewesen war. Es gab eigentlich keine Generalstände, weil diese stark integriert sind. Es gibt eine kurze Friedensperiode. 1740 bricht aber der nächste Krieg aus, der österreichische Erbfolgekrieg. Im Mittelpunkt stand die „Pragmatische Sanktion“, die Maria Theresia gezwungenermaßen durchsetzen musste. Erneut kam es zu einer Bündniskoalition. Auf Seite von Österreich war England, die nördliche NL. Auf Seite Frankreichs kämpfte nur Preußen. Die Barriere erwies sich nicht als wirksamer Schutz. Erst durch den Frieden von Aachen 1748 wurde der Konflikt beigelegt und die Pragmatische Sanktion von den Mächten anerkannt.
Belgien war nun zurück in österreichischer Hand. Die ökonomische Prosperität war aber nicht optimal, weil
1) viele Kriege herrschten
2) die protektionistische Zollpolitik Colberts (Merkantilismus) die Einfuhr stark verminderten. Auch der Handel mit England und den nördlichen Niederlanden war negativ.
3) die Schelde weiterhin geschlossen blieb. Immerhin wurde die Barriere aufgehoben von Josef II und so viel Geld gespart.
4) ein potentes Bankwesen fehlte.
5) es Getreidekrisen gab, die auch die Nahrungsversorgung belasteten
6) es kein Glück in der Kolonialpolitik gab. Obwohl 1713/14 eine Kompanie für Indienhandel (Oostende-Kompanie) gegründet wurde stieß dies auf viel Widerspruch bei Engländern und Holländern, weil diese Konkurrenz befürchteten. 1731 wurde die Kompanie aufgegeben.
Obwohl die Ausgangslage also nicht gut war, waren es die florierendsten Provinzen in der Monarchie – eine relativ große Geldmenge konnte lukriert werden. Allerdings stellte Österreich nicht so einen Absatzmarkt wie die Kolonien dar. Es gab aber einen Ausbau der Infrastruktur (Verkehr, Kanäle) im 18. Jh., vor allem ab 1740. Die Errichtung von Unternehmensansiedlungen erfolgte rein nach wirtschaftlichen Perspektiven und nicht mehr nach Zünften.
Der aufgeklärte Absolutismus (Maria Theresia, Josef II) wollte den Einfluss von Kirche, Zünften, Ständeordnung reduzieren oder überhaupt eliminieren. Die Rolle des Fürsten bzw. Staates wurde vor allem betont. So wurde sofort der Jesuitenorden verboten, staatliche Schulen wurden gefördert – „Königliche Kollegien“. Das Verbot des römischen Indexes der Katholischen Kirche und eine Lockerung der Zensur setzten ein. Es kam zur Entfaltung der Freimaurerei. Die säkulare Forschung wurde gefördert, die Akademie der Wissenschaften in Brüssel, unabhängig von der Kirche, wurde gegründet.
Cornelius Jansen (1585-1638) war Bischof Ypern und Theologieprofessor. Es wurde ihm Calvinismus vorgeworfen, weil er die These vertrat dass die göttliche Gnade ausschlaggebend sei. Er wollte zur Urkirche zurück und hatte Augustinus als Vorbild. Auch die Kirchlichkeit war wichtig für ihn, aber er relativierte das Primat des Papstes. In Pont-Royal entwickelte sich ein Zentrum (Frankreich), das stark von den Jesuiten bekämpft wurde und von päpstlichen Bullen verurteilt wurde. Im Gedanken lebte es aber fort.
Zum kulturellen Leben trug vor allem die bildende Kunst bei: Rubens (1577-1640) als Pendant zu Rembrandt, er war ebenfalls ein Diplomat. Er hatte das größte Atelier in Europa und hatte eine Arbeitsteilung. Weiters: Anthony von Dyck, ein Schüler Rubens und später bei den Stuarts in England angestellt. Jacob Jordaens, David Teniers, Jan und Pieter Breughel. Es gab finanzstarke Auftragsgeber von Adel und Kirche, die reichliche Aufträge brachten. Es gab einen sehr hohen Stand der Produktion.
1) Phase der belgischen Provinzen, partieller Aufstand
2) Union von Arras: Loyalität zu König und Katholizismus; Bruch mit den nördlichen Provinzen
3) 1598 starb Philipp II. Isabella und Albrecht übernehmen die Herrschaft und handeln 1609 einen 12-jährigen Waffenstillstand aus
4) 1621 läuft der Waffenstillstand aus. Kamphandlungen werden wieder aufgenommen, die bis 1648 dauern.
5) „Spanische Periode“, es wird weiterhin von Madrid aus regiert. Dauert bis zum Frieden von Utrecht 1713 und Rastatt 1714 – dann wird der spanische Erbfolgekrieg beendet.
6) „Österreichische Periode“, es geht nun über auf die österreichische Linie der Habsburger und dauert bis zum Revolutionsjahr 1786/89 an.
Zäsuren und Kontinuitäten:
• Katholizismus bzw. genauer die katholische Gegenreformation. Jesuiten werden als bewusstes Instrument eingesetzt, sie initiieren viele Schulgründungen. Dies darf aber auch nicht überbewertet werden, denn sie hatten kein Monopol darauf (auch Franziskaner und Dominikaner). Und Missio Hollandica wird von Rom aus stark betrieben um die nördlichen NL zu missionieren.
• Barock ist die spezifische Kunstrichtung. Weil beim Bildersturm so viel zerstört wurde hatten Barockkünstler eine gute Auftragslage.
• Wahlfahrtskirchen: wichtig für die Volksfrömmigkeit (zB Scerpenheuvel). Die Nuntiatur achtete stark darauf, ob das Konzil von Trient befolgt wurde.
• Auch die Wissenschaft wurde re-katholisiert. Unter Jean Bolland wurde eine monumentale Ausgabe von Theologen herausgebracht: Acta Sanctorum
• Einzige Religion war Katholizismus, es war wie eine Staatsreligion. Es waren zwar Protestanten die in der Garnison dienten, diese wurden geduldet, ansonsten gab es keine Toleranz. Dies war ein klarer Unterschied zur nördlichen NL, dort gab es keine Staatskirche.
• Krieg: mit 1648 wurde der 30-jährige und der 80-jährige Krieg beendet. Aber mehr oder weniger regelmäßig zogen auch danach Truppen durch Belgien.
• Wiederholte Versuche zur Zentralisierung auf Kosten der Provinzen, Zünfte und Gilden. Dagegen gab es immer Widerstand. So gab es einen Aufstand in Brüssel 1718. Höhepunkt war die Brabantische Revolution. Oft Widerstände, aber die Loyalität wurde nicht aufgekündigt. Es gab den Versuch einer engen Anbindung an die beiden Habsburger Linien. Es wurde je ein Hoher Rat eingerichtet in Brüssel um eine Kommunikationsplattform zu haben. Kaunitz sorgte in den 1750ern für eine noch engere Bindung. Er löste den Hohen Rat ab und gliederte sie in seine eigenen Kompetenzen ein.
Verwaltungsorgane:
• Generalstatthalter oder Generalgouverneur: zB Prinz Eugen von Savoyen, es ist immer ein hoher Adeliger. In Spanien war dieser Posten immer von Fluktuation gezeichnet weil er ein Durchgangsposten war. In österreichischen Zeiten änderte sich dies.
• Bevollmächtigter Minister: dies war ein hoher Karrierediplomat aus angesehener Familie. Zwar formal dem Gouverneur unterstellt, aber er hatte die Möglichkeit direkt in den Kontakt mit dem Kaiser zu treten. Dies ging auf Kosten des Gouverneurs, der nur mehr eine Repräsentationsrolle innehatte. Josef II vertraute Karrierediplomaten ohnehin viel eher als seiner eigenen Verwandtschaft, er lehnte Änderungen ab.
• Kollaterale Räte: so wie bereits 1531: Geheimer Rat, Staatsrat und Finanzrat. Karl VI versuchte dies zu ersetzen mit einem allgemeinen Regierungsrat um Kostenersparnis und Effizienzsteigerung der Bürokratie zu erzielen. Es gab aber enormen Widerstand der Bevölkerung dagegen, erst Josef II konnte hier Reformen durchsetzen.
• Auf der Ebene der 10 Provinzen: Provinzstatthalter (repräsentativ) aus einheimischem Adel. Der Kanzler war Chef der provinzialischen Verwaltung und kam aus dem niederen Adel, genauso wie Spitzenbeamte, Provinzialräte (administrativ und justiziell). Im Prinzip aus dem 16. Jh. übernommen und im Kern bis zur Revolution ihre Funktion beibehalten.
Grundzüge der Außenpolitik:
Frankreich wurde mehrfach zur Bedrohung, vor allem unter Ludwig XIV, dies hatte mit dem Niedergang der Spanier zu tun. Als Konsequenz des spanisch-französischen Krieges 1635 wurde mit dem Pyrenäen-Frieden 1659 beendet. Dabei musste Spanien einige Teile im Süden abgeben, die südliche NL wurde so deutlich reduziert. Gegen die Forderung die gesamte südliche NL an Ludwig XIV abzutreten trat Karl II aber entschieden dagegen auf. Er setzte das Devolutionsrecht ein um für seine Nachkommen die spanischen NL einzufordern. Frankreich zwang Spanien 1667/68 weitere Gebiete an Frankreich abzutreten. So wurde die südliche NL wiederum dezimiert, während sich Frankreich stabilisierte. Es gab weitere Kriege durch dynastische Zwiste im spanischen Erbfolgekrieg. Die Folgen waren beträchtlich. Spanien ging von den Habsburgern zu den Bourbonen über. Die südlichen NL wurden nun an Österreich übergeben, denn Karl II starb kinder- und erbenlos. Es gab drei Bewerber um seine Nachfolge:
1) Philipp von Anjou, der auch das Rennen macht als Philipp V. Ludwig XIV forderte nun, dass die südliche NL Frankreich angeschlossen wird und seinem Enkel übergeben wird, was enorme Machtfülle bedeutet hätte.
2) Dies rief die Habsburger auf den Plan. Für Leopold I war dies eine Bedrohung und er setzt Erzherzog Karl, den späteren Karl II ein.
3) Kronprinz Ferdinand von Bayern, der aber bald starb und so aus dem Rennen war.
Es bildeten sich zwei Machtblöcke. Auf der einen Seite stand der Kaiser, der mit England, Preußen, den nördlichen NL, dem Kurfürstentum Hannover und Savoyen verbunden war. Frankreich hingegen wurde vom Erzbistum Köln und von Bayern unterstützt. Dieser Krieg kann durchaus als der erste Weltkrieg der FN bezeichnet werden. Frankreich erwies sich – überraschenderweise – als schwächer als gedacht. Prinz Eugen und Herzog von Marlborough besetzten weite Teile der südlichen NL. Ab 1706 gab es ein Anglo-Batavisches Kondominium. Als Souverän wurde Erzherzog Karl ernannt. In Spanien wurde Karl III König, sein Spielraum war aber sehr begrenzt.
Das Ergebnis waren die Friedensschlüsse von 1713 und 1714. Dies wurde möglich, weil Philipp V auf die Erbfolge in Frankreich verzichtete und ihm nur Spanien blieb. Die Union blieb also aus, die der Rest so befürchtet hatte. Die belgischen Provinzen gingen an die österreichische Linie der Habsburger. Als Bedingung musste Österreich die 30.000 Barrieresoldaten bezahlen, was immerhin 1 Mio. Gulden pro Jahr kostete. Die Schelde blieb weiterhin geschlossen, was Hemmnisse für den Handel bedeutete. Eine weitere Einschränkung war der Umstand, dass der Überseehandel untersagt wurde – dies hatte wohlweislich England und die nördliche NL durchgesetzt.
1713 erließ Karl VI die „Pragmatische Sanktion“ um die Erbfolge zu regeln um das Reich zusammenzuhalten. 1725 ließ er dieses bestätigen, was bemerkenswert ist, weil es seit 1634 nicht mehr der Fall gewesen war. Es gab eigentlich keine Generalstände, weil diese stark integriert sind. Es gibt eine kurze Friedensperiode. 1740 bricht aber der nächste Krieg aus, der österreichische Erbfolgekrieg. Im Mittelpunkt stand die „Pragmatische Sanktion“, die Maria Theresia gezwungenermaßen durchsetzen musste. Erneut kam es zu einer Bündniskoalition. Auf Seite von Österreich war England, die nördliche NL. Auf Seite Frankreichs kämpfte nur Preußen. Die Barriere erwies sich nicht als wirksamer Schutz. Erst durch den Frieden von Aachen 1748 wurde der Konflikt beigelegt und die Pragmatische Sanktion von den Mächten anerkannt.
Belgien war nun zurück in österreichischer Hand. Die ökonomische Prosperität war aber nicht optimal, weil
1) viele Kriege herrschten
2) die protektionistische Zollpolitik Colberts (Merkantilismus) die Einfuhr stark verminderten. Auch der Handel mit England und den nördlichen Niederlanden war negativ.
3) die Schelde weiterhin geschlossen blieb. Immerhin wurde die Barriere aufgehoben von Josef II und so viel Geld gespart.
4) ein potentes Bankwesen fehlte.
5) es Getreidekrisen gab, die auch die Nahrungsversorgung belasteten
6) es kein Glück in der Kolonialpolitik gab. Obwohl 1713/14 eine Kompanie für Indienhandel (Oostende-Kompanie) gegründet wurde stieß dies auf viel Widerspruch bei Engländern und Holländern, weil diese Konkurrenz befürchteten. 1731 wurde die Kompanie aufgegeben.
Obwohl die Ausgangslage also nicht gut war, waren es die florierendsten Provinzen in der Monarchie – eine relativ große Geldmenge konnte lukriert werden. Allerdings stellte Österreich nicht so einen Absatzmarkt wie die Kolonien dar. Es gab aber einen Ausbau der Infrastruktur (Verkehr, Kanäle) im 18. Jh., vor allem ab 1740. Die Errichtung von Unternehmensansiedlungen erfolgte rein nach wirtschaftlichen Perspektiven und nicht mehr nach Zünften.
Der aufgeklärte Absolutismus (Maria Theresia, Josef II) wollte den Einfluss von Kirche, Zünften, Ständeordnung reduzieren oder überhaupt eliminieren. Die Rolle des Fürsten bzw. Staates wurde vor allem betont. So wurde sofort der Jesuitenorden verboten, staatliche Schulen wurden gefördert – „Königliche Kollegien“. Das Verbot des römischen Indexes der Katholischen Kirche und eine Lockerung der Zensur setzten ein. Es kam zur Entfaltung der Freimaurerei. Die säkulare Forschung wurde gefördert, die Akademie der Wissenschaften in Brüssel, unabhängig von der Kirche, wurde gegründet.
Cornelius Jansen (1585-1638) war Bischof Ypern und Theologieprofessor. Es wurde ihm Calvinismus vorgeworfen, weil er die These vertrat dass die göttliche Gnade ausschlaggebend sei. Er wollte zur Urkirche zurück und hatte Augustinus als Vorbild. Auch die Kirchlichkeit war wichtig für ihn, aber er relativierte das Primat des Papstes. In Pont-Royal entwickelte sich ein Zentrum (Frankreich), das stark von den Jesuiten bekämpft wurde und von päpstlichen Bullen verurteilt wurde. Im Gedanken lebte es aber fort.
Zum kulturellen Leben trug vor allem die bildende Kunst bei: Rubens (1577-1640) als Pendant zu Rembrandt, er war ebenfalls ein Diplomat. Er hatte das größte Atelier in Europa und hatte eine Arbeitsteilung. Weiters: Anthony von Dyck, ein Schüler Rubens und später bei den Stuarts in England angestellt. Jacob Jordaens, David Teniers, Jan und Pieter Breughel. Es gab finanzstarke Auftragsgeber von Adel und Kirche, die reichliche Aufträge brachten. Es gab einen sehr hohen Stand der Produktion.
itdoesnotmatter - 2. Dez, 21:16